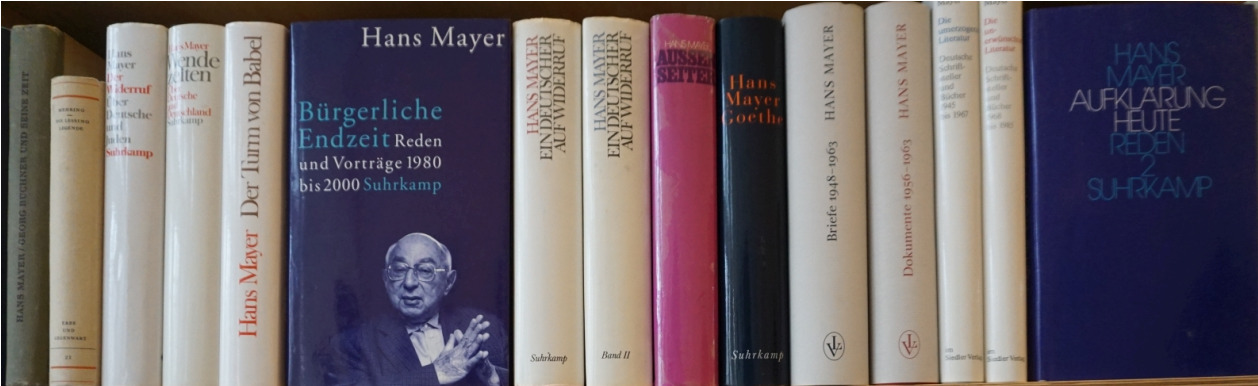Zum 105. Geburtstag von Paul »Pessach« Antschel
Paul Antschel wurde am 23. November 1920 in der ehemals österreich-ungarischen Bukowina und zu seiner Geburt zu Rumänien gehörenden Stadt Czernowitz geboren. Er war der einzige Sohn von Leo Antschel-Teitler und dessen Ehefrau Friederike (genannt „Fritzi“) geborene Schrager. Die junge Familie hatte eine kleine Wohnung in der Wassilkogasse 5 in Czernowitz bezogen und wohnte dort in drei Zimmern mit weiteren Familienangehörigen.[i]
Die Geburt im Sternzeichen des Schützen hat für die jüdischen Eltern keine Bedeutung. Entgegen Goethe, der seine Autobiografie „Dichtung und Wahrheit“ mit dem berühmten Satz über die Sternstunde seiner Geburt beginnt, kommt Paul erst spät auf diesen Kontext. Ruth Lackner, eine der ersten Freundinnen, weist auf die Passage im Gedicht „Beim Hagelkorn“ aus der „Zeitenwende“ hin.
[…] den harten
Novembersternen gehorsam:
[…]
eine Sehne, von der
deine Pfeilschrift schwirrt,
Schütze.[ii]
Pauls Vater war ein strenger Erzieher. Der Sohn musste frühzeitig lernen zu gehorchen. Verhielt er sich dementsprechend nicht, wurde er gerügt und bekam sogar Schläge. War das Vergehen „besonders groß“ wurde er in ein leeres Zimmer eingesperrt und der Vater verließ das Haus. Das gab der liebenden Mutter und anderen Frauen im Haus die Chance, den Jungen zu befreien.[iii] Im kleinen Hof hinter dem Haus lag das Sommerparadies des kleinen Jungen. Es ging allerdings nur bis zum Zaun. Alles andere lag „drüben“. So heißt es in einem der Jugendgedichte:
Erst jenseits der Kastanien ist die Welt.
Von dort kommt nachts ein Wind im Wolkenwagen
und irgendwer steht auf dahier…
Den will er über die Kastanien tragen:
»Bei mir ist Engelsüß und roter Fingerhut bei mir!«
Erst jenseits der Kastanien ist die Welt.
[…]
Doch wenn die Nacht auch heut sich nicht erhellt
und wiederkommt der Wind im Wolkenwagen:
»Bei mir ist Engelsüß und roter Fingerhut bei mir!«
Und will ihn über die Kastanien tragen –
dann halt, dann halt ich ihn nicht hier…
Erst jenseits der Kastanien ist die Welt.“[iv]
Israel Chalfen, der Autor der Jugend-Biografie, weist im Zusammenhang mit der Beschreibung der Familie Pauls darauf hin, welche Einflüsse für den Heranwachsenden damit gegeben sind. Aus der Familie des Vaters, den Teitlers, wird das Judentum vermittelt. Bei den Antschels ist es die Naturnähe und bei den Schraders und den Ehrlichs die Nähe zur deutschen Sprache.[v]
Natürlich spielt auch die Landschaft eine wesentliche Rolle. Diese Region der Bukowina gehörte nach einem langen 18. Jahrhundert zu Rumänien und hieß fortan Cernăuţi, danach ging sie von 1940 bis 1941 an die Sowjetunion, von 1941 bis 1944 an Rumänien, dann von 1944 bis 1991 wieder an die Sowjetunion und heute gehört diese Stadt zur Ukraine.
In seiner Ansprache anlässlich der Entgegennahme des Literaturpreises der Freien Hansestadt Bremen im Jahr 1958 formulierte Celan:
„Die Landschaft, aus der ich – auf welchen Umwegen! Aber gibt es das denn: Umwege? – die Landschaft, aus der ich zu Ihnen komme, dürfte den meisten von Ihnen unbekannt sein. Es ist die Landschaft, in der ein nicht unbeträchtlicher Teil jener chassidischen Geschichten zu Hause war, die Martin Buber uns allen auf Deutsch wiedererzählt hat. Es war, wenn ich diese topografische Skizze noch um einiges ergänzen darf, das mir, von sehr weit her, jetzt vor die Augen tritt – es war eine Gegend, in der Menschen und Bücher lebten.“ [vi]
Nach den Forschungen von Israel Chalfen, Barbara Wiedemann-Wolf, Gerhart Baumann, Petre Solomon sowie Edith Silbermann ist jene „Gegend, in der Menschen und Bücher lebten“ ein zumindest von den historisch erinnernden Beschreibungen her ein Land, über das viel an Wissen zurückgewonnen ist. Sehr konkret auch über vieles aus der Jugend von Paul Antschel.
Diese wechselvolle Geschichte der Region prägte nicht nur die kulturelle Vielfalt, sondern hinterließ auch ihre Spuren in der Identität und den Erinnerungen der dort lebenden Menschen. Besonders für Paul Antschel war die Bukowina nicht nur geografischer Herkunftsort, sondern Quelle literarischer Inspiration und ein Ort tiefer Verbundenheit, der seine Dichtung maßgeblich beeinflusste.
Das Jahr 1933 brachte für die Familie Antschel einen sehr erfreulichen Wechsel in der Wohnsituation. Die Kusinen Klara und Emma Nagel, die Paul in seiner Kindheit oft betreut hatten, verließen das Haus und Tante Minna zog mit ihrem Mann nach Palästina. Paul erhielt sein eigenes Zimmer mit dem Ausblick auf die Kastanienallee. Paul beschloss das vierte Jahr der gymnasialen Unterstufe und feierte seine »Bar Mizwa«. Der damit verbundene traditionelle Vorgang musste ausreichend vorbereitet werden und verlief nach sehr strengen rituellen Regeln ab.[vii]
Mit der »Bar Mizwa« endete auch Pauls Hebräisch-Unterricht, er fühlte sich befreit. In späteren Gedichten des Erwachsenen finden sich aber in den „Sprachgittern“, der „Niemandsrose“ und „Atemwende“ Reminiszenzen an dies einschneidende Erlebnis der Jugend. Die Erinnerung daran und ihre stille Fortwirkung spielte auch eine Rolle bei der ersten Begegnung von Celan und Hans Mayer bei einer Tagung in Wuppertal. In einer Festschrift zum 6o. Geburtstag von Hans Mayer hat sie ihren Niederschlag in einem Gedicht von Celan gefunden: „Weißgeräusche“ erinnerte, daran, wie die beiden sich kennengelernt hatten. Es war eine Tagung des „Bundes“ 1957 in Wuppertal. Das Thema: »Literaturkritik – kritisch betrachtet«. Versammelt war ein illustrer Kreis, unter ihnen Heinrich Böll, Ingeborg Bachmann Paul Celan, Hans Magnus Enzensberger und Walter Jens. In seinen Erinnerungen hält Hans Mayer fest: „Zwei Juden erkennen einander. Sie entdecken die geheimen Gebetsriemen am Handgelenk des anderen.“[viii]
WEISGERÄUSCHE, gebündelt,
Strahlen-
gänge
über den Tisch
mit der Flaschenpost hin….[ix]
Das Gedicht, so Mayer, hätte auch die Überschrift tragen können: »Wuppertal, Oktober«. Orte, wie an erster Stelle Czernowitz, spielten in vielen Gedichten Celans eine Rolle. Helmut Böttiger hat sich diesem Thema intensiv gewidmet.
„Czernowitz, das war ein eigener kleiner Kosmos, eine Stadtkultur, eine Cafébesessenheit. Paul Celan, aber auch Rose Ausländer oder Gregor von Rezzori sind vom Geist von Czernowitz geprägt; der psychisch gereizte Wilhelm Reich kommt von dort und Ninon, die Frau, der Hermann Hesse zuletzt dann endgültig verfallen ist. Und was in Wien, der unerreichbaren Metropole, zur Zeit der Jahrhundertwende der Literaturbeschleuniger Hermann Bahr war, einer, der überall seine Finger mit im Spiel hatte und ständig neue Aktionen organisierte, ohne selbst als Dichter sonderlich erwähnenswert zu sein: das war in Czernowitz Alfred Margul-Sperber – Sperber, der, wie Karl Kraus im Februar 1929 in der Fackel schrieb, »von Storojinetz bei Cernauti gewissenhafter die Interessen der Kultur betreut, als es im Raum zwischen Berlin und Wien geschieht«“.[x]
Bereits in dieser Zeit begann Paul, sich intensiv mit Literatur und Sprache auseinanderzusetzen. Das eigene Zimmer bot ihm einen Rückzugsort, an dem er ungestört lesen und schreiben konnte. Seine Begeisterung für Gedichte und literarische Werke zeigte sich nicht nur in der Schule, sondern auch im familiären Alltag, wo er häufig Gedichte vortrug und eigene Texte verfasste.
Zu Beginn des Schuljahres 1934/35 steht für Paul der Übergang in die Oberstufe des Gymnasiums an. Damit verbunden ist ein Schulwechsel, insbesondere wohl wegen des wachsenden Antisemitismus an seiner alten Schule. Das rumänische Staatsgymnasium besaß einen liberalen Ruf. Die Mehrheit der Schüler dort waren Juden. Für den wissbegierigen und viel lesenden Paul waren viele Stunden zu langweilig. Den Klassenkameraden war er in seinem Wissen stets voraus und auch gegenüber den Lehrern konnte er mit seinem Wissen dominieren. Während die Klasse noch bei Schiller und Goethe waren, las er schon Hölderlin und Rilke. Von seinen Mitschülern wurde er mehr und mehr bewundert. Im Frühjahr 1934 gab es auch eine Verbesserung für das Familienleben. Man zog in eine neue größere Wohnung in der Masarykgasse Nr. 10.
Allen Freundinnen und Freunden Pauls war klar, dass er seine Mutter anbetete. Von seinem Vater löste er sich innerlich vollkommen. Dazu zählte auch, dass er sich gegen die Auffassung des Vaters eine linksgerichtete Weltanschauung aneignete. Fairerweise muss man sagen, dass der Vater sich Sorgen wegen der politischen Ausrichtung seines Sohnes machte. Die ersten sozialpolitischen Reflexionen erhielt Paul wohl von seinem Onkel Esriel.“[xi] Noch im Sommer beteiligte er sich an den Treffen der illegalen »Antifaschistischen Jugend«.[xii] Beim Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges ließ sich Paul „zum ersten und einzigen Mal „zu einer politischen Aktion überreden: er sammelte Spenden für die »Rote Hilfe«. Marx und Engels waren eher nicht seine Autoren. Er schätzte anarchistische Kommunisten wie Pjotr Kropotkin oder Gustav Landauer.
Literarisch ist Paul von Rilke fasziniert.
„…in den ersten Gedichten Celans ist die Aufnahme des Rilkeschen Tons, seiner Farbigkeit, seiner Bilderwelt, Zeile um Zeile zu verfolgen:
Kein ankerloses Tasten stört die Hand
und nachts verstreutes Heimweh trägt die Not
gefalteter Gebete zitternd hin vors Rot
im Bangen deiner Züge, dunkeler gespannt.
Der Cornet muß eine prägende Jugendlektüre gewesen sein, noch im Band Mohn und Gedächtnis sind einige Anklänge daran zu spüren.“[xiii]
Diese „Rilke-Melodie“ spiegelt sich auch in den Gedichten wider, die Paul an seine Freundin Ruth Lackner geschickt hat.
Eine weitere wichtige Freundin in dieser Zeit ist für Paul Edith Silbermann, geborene Horowitz. Ihr Vater war Altphilologe und Germanist mit einer der größten Privatbibliotheken der Stadt. Eine Fundgrube für den lesewütigen Paul. Dort fand er auch die Landarzt-Erzählungen Kafkas. Kafka wurde für ihn, wie er Ruth Lackner gegenüber gesagt hat, vor allem in späteren Jahren zur täglichen Lektüre.
Im Juni 1938 machte Paul sein Abitur. Auf Wunsch der Eltern sollte er Medizin studieren. Das war für Juden zu dem Zeitpunkt in Czernowitz nahezu unmöglich. Also fiel die Entscheidung auf Tours in Frankreich, wohin auch einige Bekannte und Freunde Pauls wie Manuel Singer gingen. Am Morgen des 9. November 1938 steigt Paul in den Zug. Seine Reise führt ihn über Berlin. Eine damalige Ahnung am Anhalter Bahnhof hält er in einem späteren Gedicht »La Contrescarpe« in der »Niemandsrose« fest.
„[…] Über Krakau
bist du gekommen, am Anhalter
Bahnhof
floß deinen Blicken ein Rauch zu,
der war schon von morgen. Unter
Paulownien
sahst du die Messer stehn, […]“[xiv]
Paul kommt in den Sommerferien nach Czernowitz zurück. Doch es brechen düsterere Zeiten an. Am 20. Juni 1940 kommen sowjetische Truppen nach Czernowitz und bleiben dort ein Jahr. Für Paul besteht die Chance sein Romanistikstudium fortzusetzen. Das Niveau an der Uni ist aber denkbar niedrig. Doch als Student erhält Paul ein Gehalt als Universitätshörer, dass ihm sogar die Unterstützung seiner Eltern ermöglicht.[xv] Der ideologische Druck und die Verpflichtung für das Studium des Marxismus-Leninismus sind allerdings für Paul schwer erträglich.
Nach Hitlers Überfall auf die Sowjetunion können die Sowjets die Bukowina nicht mehr halten. Doch unter ihrer Herrschaft wurden noch Tausende von Einwohnern nach Sibirien verschleppt. Die größere Katastrophe geschieht im Juli 1941, als die Rumänen unter deutschem Kommando der Einsatzgruppe D unter dem SS-Brigadeführer Ohlendorf einmarschieren. Es folgten Deportierungen, Ghetto und organisierter Mord. Die dramatisch-traumatische Schlüsselsituation für Paul ereignet sich im Sommer 1942. Die Deportationen in die Straflager von Transnistrien fanden an den Wochenenden statt; er hatte rechtzeitig ein Versteck für sich und seine Eltern ausfindig gemacht Er konnte sie jedoch nicht überreden, mit ihm dorthin zu gehen. Als er am Montag darauf zum Haus der Eltern ging, war dies versiegelt. Die Eltern waren in ein Arbeitslager am südlichen Fluss Bug transportiert worden. Im August wurden sie in das Lager Michailowka transportiert. Der Vater starb im Herbst 1942. Durch einen Brief seiner Mutter erfuhr Paul davon und hat das in dem Gedicht „Schwarze Flocken“ festgehalten.
„Schnee ist gefallen, lichtlos. Ein Mond
ist es schon oder zwei, daß der Herbst unter mönchischer Kutte
Botschaft brachte auch mir, ein Blatt aus ukrainischen Halden:
[…]
O Eis von unirdischer Röte – es watet ihr Hetman mit allem
Troß in die finsternden Sonnen . . . Kind, ach ein Tuch,
mich zu hüllen darein, wenn es blinket von Helmen,
wenn die Scholle, die rosige, birst, wenn schneeig stäubt das Gebein
deines Vaters, unter den Hufen zerknirscht
das Lied von der Zeder ….
[…]
Blutete, Mutter, der Herbst mir hinweg, brannte der Schnee mich:
sucht ich mein Herz, daß es weine, fand ich den Hauch, ach des Sommers,
war er wie du.
Kam mir die Träne. Webt ich das Tüchlein.“[xvi]
Paul entkam der Deportation und wurde bis Februar 1944 als Zwangsarbeiter in ein Arbeitslager in Tabăresti bei Buzău eingezogen. Von dort schickt er seiner Freundin Ruth viele Gedichte. Die Nachricht von der Ermordung seiner Mutter durch Genickschuss erreicht Paul über Benno Teitler, einen entfernten Verwandten, der vom Fluß Bug flüchten konnte.
Anfang 1944 ziehen die Deutschen ab und Paul kann zurück nach Czernowitz. Die jungen Leute, die überlebt haben, treffen sich wieder und so lernt Paul auch Rose Ausländer kennen. Sie bewundert den jungen Dichter und findet auch nichts dabei, dass er aus einem ihrer Gedichte, das 1939 veröffentlicht wurde, das berühmte Oxymoron „schwarze Milch“ übernimmt. „Daß Paul die Metapher >schwarze Milch<, die ich in meinem 1925 geschriebenen, jedoch erst 1939 veröffentlichten Gedicht >Ins Leben< geschafft habe, für die >Todesfuge< gebraucht hat, erscheint mir nur selbstverständlich, denn der Dichter darf alles als Material für die eigene Dichtung verwenden. Es gereicht mir zur Ehre, daß ein großer Dichter in meinem frühen Werk eine Anregung gefunden hat.“[xvii]
Im Herbst 1944 eröffnen die Sowjets erneut die russisch-ukrainische Universität. Paul kann sein Studium wieder aufnehmen. Neben Französisch schreibt er sich auch für Anglistik ein. Im April 1945 rüsten sich Paul und einige Verwandte für die Ausreise nach Rumänien. Sie können nach Bukarest gehen. Dort erscheint am 2. Mai zum ersten Mal die von Pauls Freund Petre Salomon ins Rumänische übersetzte, »Todesfuge« unter dem Titel »Todestango«. Der Dichter nennt sich von da an Paul Celan.
Heinrich Bleicher
[i] Zu den konkreten Wohn – und Lebensbedingungen siehe Israel Chalfen, Paul Celan – Eine Biografie seiner Jugend, Frankfurt am Main 1983, S. 25 ff
Da ich in diesem Beitrag über die Jugendzeit Celans in Czernowitz rede, werde ich ihn, wie Thomas Sparr in seinem Buch „Todesfuge“ als Paul Antschel benennen. Siehe Thomas Sparr, todesfuge – Biografie eines Gedichtes, München 2020 hier S. 9-69.
[ii] Paul Celan, Die Gedichte, herausgegeben und kommentiert von Barbara Wiedemann, Frankfurt am Main 2005, S. 178
[iii] Siehe Chalfen, S. 36ff
[iv] Paul Celan, Die Gedichte, S. 13. Das Gedicht in etwas anderer Schreibweise ist auch enthalten in dem Band Paul Celan, Gedichte 1938-1944, mit einem Vorwort von Ruth Kraft. An diese Freundin hatte Paul die meisten der frühen Gedichte gesandt.
[v] Siehe Chalfen, S. 35
[vi] Paul Celan, Ausgewählte Gedichte. Zwei Reden, Frankfurt am Main 1968, S. 131-148
[vii] Siehe Chalfen, S. 49f
[viii] Hans Mayer, Ein Deutscher auf Widerruf Bd. II, S. 228
[ix] Celan, Die Gedichte, S. 234
[x] Helmut Böttiger, Orte Paul Celans, Wien 1996, S. 24
[xi] Chalfen, S. 62
[xii] A.a.O., S.62ff
[xiii] Böttiger, Orte, S. 25
[xiv] Celan, Die Gedichte, S. 161
[xv] Chalfen, S. 93
[xvi] Celan, Die Gedichte, S. 19
[xvii] Zitiert nach Chalfen, S. 133